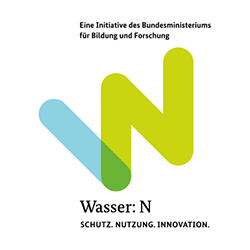Am 12. Dez. 2023 trat die neue Trinkwassereinzugsgebieteverordnung in Kraft, die eine umfangreiche Bestimmung und Beschreibung des Einzugsgebietes fordert (§6). Darüber hinaus müssen mögliche Gefährdungen analysiert und ein resultierendes Risiko abgeschätzt werden (§7). Bis zum 12. Nov. 2025 muss den jeweilig zuständigen Behörden eine entsprechende Dokumentation vorgelegt werden. [1,2]
Angewandte Methodik
Im Projekt iMolch wurden insgesamt seit August 2023 zahlreiche Monitoringproben (haupts. Grundwasserproben) in Düsseldorf und Dormagen genommen und mittels IC und LC-MS/MS auf anorganische Hauptionen und organische Spurenstoffe mittels Hot- und Non-Target-Analytik untersucht. Zudem wurden die Proben biologisch auf ihre mikrobielle Diversität (ß-Diversität) hin betrachtet und statistisch ausgewertet. Auch wurden Proben auf anorg. Spurenelemente untersucht (ICP-MS) und hydrochemische Parameter mittels einer Durchflusszelle während der Probennahmen geloggt. Diese Datensätze stellen unter anderem die Grundlagen für Modellierungen im Verbundprojekt: Hiermit wurden Modellbetrachtungen von Strömungs- und Transportprozessen durchgeführt.
Des Weiteren wurden die Standortbedingungen recherchiert: Geologie, Grundwasser- und Rheinpegelstände,Informationen zu Wasserhaltungen und Grundwasserneubildung flossen in ein Grundwasserströmungsmodell ein. Bohrprofile und geologische Schnitte wurden ausgewertet, um ein geologisches Strukturmodell aufzubauen.

Bild oben: Standort „Zonser Grind“ in Dormagen, (Quelle: TU Berlin)

Erzielte Ergebnisse und Ausblick
Es wurden neue Werkzeuge zur Datenanalyse angewendet, die Veränderungen in großen Datensätzen schnell erfassen können (neuronale Netzwerke) und so mögliche Gefahren frühzeitig erkennen. Darüber hinaus fanden wir eine eindeutige Korrelation zwischen unseren aufsummierten landwirtschaftlichen Indikatoren und Nitrat: Ein xy-Plot beider Parameter lieferte für eine lineare Regression ein R2 von 0,935 (und keine Korrelation für ein urbanes Gebiet). Es ist geplant, die Ergebnisse der Spurenelemente zu nutzen um im Labormaßstab mittels Säulenversuche die wichtigsten, transport-bestimmenden Parameter zu ermitteln. Darüber hinaus werden Langzeitdatensätze der Standorte „Flehe“ und „auf dem Grind“ statistisch ausgewertet und in ein Geoinformations-system implementiert.
Für die mikrobielle Diversität ergaben sich sinnvolle Clusterungen der Rhein- und Grundwässer und bei einem Hochwasserereignis* eine Infiltration in das Grundwasser im Uferbereich des Rheins. Die mikrobielle Gemeinschaft ist hier jedoch widerstandsfähig und bildete sich nach dem Hochwasser wieder zurück (Resilienz). Die erhaltenen Datensätze werden für die Bestimmungen der Humifikation und des biologischen Index verwendet, aus der ein neuer Ökoqualitätsindex entwickelt werden soll. Ziel ist die erstmalige, gemeinsame chemische und biologische Bewertung des Grundwassers im Einzugsgebiet.
Für das Gebiet der Wassergewinnung „Auf dem Grind“ wurde zunächst ein konzeptionelles Modell erstellt. Dessen Ausdehnung orientiert sich prinzipiell an den Wasserschutzzonen der Wassergewinnung (I bis III B). Die Implementierung verschiedener Randbedingungen, wie die Horizontalfilterbrunnen sind noch problematisch und werden zurzeit mit verschiedenen Softwarepaketen angegangen. Nachdem das Modell fertiggestellt ist, sollen verschiedene Szenarien, wie Niedrig- oder Hochwasser berechnet werden und final der Stofftransport implementiert werden. Dann können Bewirtschaftungskonzepte abgeleitet werden.
Bild oben: Standort „Zonser Grind“ in Dormagen, (Quelle: TU Berlin)
Anhand hydrochemischer Daten im Einzugsgebiet Flehe werden relevante Prozesse und potenzielle Stoffverhaltensklassen identifiziert. Darauffolgend werden mittels numerischer Studien im Kontext verschiedener Szenarien Veränderungen der Strömungs- und Transportprozesse simuliert und auf diverse Standorte der Uferfiltration abgeleitet. Dies ermöglicht es, potenzielle Gefahren für das Grundwasser zu klassifizieren und im Vorfeld einzuschätzen. Die Ergebnisse sollen das Bewirtschaftungskonzept resilienter gestalten.
*: Dieses bildete den Höchststand seit Beginn des iMOLCH-Monitorings ab.
03/12/2024

Bild oben: Standort SWD in Flehe, Düsseldorf, (Quelle: TU Berlin)
Quellen:
[1]: https://www.lanuv.nrw.de/themen/wasser/wasserversorgung-und-trinkwasser/umsetzung-der-trinkwassereinzugsgebiete-verordnung-in-nrw
[2]: https://www.gesetze-im-internet.de/trinkwegv/BJNR15A0A0023.html